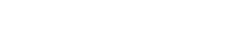Verletzungen des Gelenkknorpels in verschiedenen Gelenken, einschließlich des Knies, sind schmerzhaft und schränken die Beweglichkeit ein. Daher entwickeln Forscher der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel Knorpelimplantate aus Zellen der Nasenscheidewand des Patienten. Eine aktuelle Studie zeigt, dass eine längere Reifezeit dieser Knorpelimplantate die klinische Wirksamkeit deutlich verbessert, selbst bei Patienten mit komplexen Knorpelverletzungen. Dies deutet darauf hin, dass die Methode auch zur Behandlung von degeneriertem Knorpel bei Arthrose geeignet sein könnte.
Wie Zellen der Nasenscheidewand selbst schwierige Knorpelverletzungen heilen können
Ein unglücklicher Sturz beim Skifahren oder Fußballspielen kann das Ende sportlicher Aktivitäten bedeuten. Schäden am Gelenkknorpel heilen nicht von selbst und erhöhen das Risiko einer Arthrose. Forscher der Universität Basel und des Universitätsspitals Basel haben nun gezeigt, dass selbst komplexe Knorpelverletzungen mit Ersatzknorpel aus Zellen der Nasenscheidewand repariert werden können.

Ein Team um Professor Ivan Martin, Dr. Marcus Mumme und Professor Andrea Barbero entwickelt diese Methode seit mehreren Jahren. Dabei werden die Zellen aus einem winzigen Stück Nasenscheidewandknorpel des Patienten entnommen und können sich dann im Labor auf einem Gerüst aus weichen Fasern vermehren. Schließlich wird der neu gewachsene Knorpel in die gewünschte Form geschnitten und in das Kniegelenk implantiert. Frühere Studien haben bereits vielversprechende Ergebnisse gezeigt. „Nasenseptumknorpelzellen haben besondere Eigenschaften, die sich ideal für die Knorpelregeneration eignen“, erklärt Professor Martin. So hat sich beispielsweise herausgestellt, dass diese Zellen Entzündungen in den Gelenken entgegenwirken können.
Ausgereifterer Knorpel zeigt bessere Ergebnisse
In einer klinischen Studie mit 98 Teilnehmern in Kliniken in vier Ländern verglichen die Forscher zwei experimentelle Ansätze. Eine Gruppe erhielt Knorpeltransplantate, die vor der Implantation nur zwei Tage im Labor gereift waren – ähnlich wie bei anderen Knorpelersatzprodukten. Bei der anderen Gruppe durften die Transplantate zwei Wochen lang reifen. Während dieser Zeit nimmt das Gewebe Eigenschaften an, die dem natürlichen Knorpel ähneln.
Nach dem Eingriff bewerteten die Teilnehmer 24 Monate lang ihr Wohlbefinden und die Funktionalität des behandelten Knies anhand von Fragebögen. Die Ergebnisse, die in der Fachzeitschrift Science Translational Medicine veröffentlicht wurden, zeigten in beiden Gruppen eine deutliche Verbesserung. Bei den Patienten, die reiferen künstlichen Knorpel erhalten hatten, setzte sich die Verbesserung jedoch auch im zweiten Jahr nach dem Eingriff fort, sodass sie die Gruppe mit weniger reifen Knorpeltransplantaten überholten.
Die Magnetresonanztomographie (MRT) zeigte außerdem, dass die reiferen Knorpeltransplantate zu einer besseren Gewebezusammensetzung an der Implantationsstelle und sogar im benachbarten Knorpel führten. „Die längere Reifezeit im Vorfeld lohnt sich“, betont Anke Wixmerten, Co-Hauptautorin der Studie. Die zusätzliche Reifezeit des Implantats, so betont sie, erfordere nur einen geringen Mehraufwand und höhere Herstellungskosten und führe zu viel besseren Ergebnissen.
Besonders geeignet bei größeren und komplexeren Knorpelverletzungen
Es sei laut den Forschern bemerkenswert, dass Patienten mit größeren Verletzungen von Knorpeltransplantaten mit längeren vorherigen Reifezeiten profitieren. Dies gelte auch für Fälle, in denen frühere Knorpelbehandlungen mit anderen Techniken erfolglos waren. Die Studie der Forscher beinhaltete keinen direkten Vergleich mit aktuellen Behandlungsmethoden. Wenn sie sich jedoch die Ergebnisse von Standardfragebögen ansehen, erzielten die mit ihrem Ansatz behandelten Patienten langfristig weitaus höhere Werte in Bezug auf die Gelenkfunktionalität und die Lebensqualität. Auf der Grundlage dieser und früherer Erkenntnisse planen die Forscher der Abteilung für Biomedizin nun, diese Methode zur Behandlung von Arthrose zu testen – einer entzündlichen Erkrankung, die zu einer Degeneration des Gelenkknorpels führt und chronische Schmerzen und Behinderungen verursacht.
Zwei groß angelegte klinische Studien, die vom Schweizerischen Nationalfonds und dem EU-Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe finanziert werden, stehen kurz vor dem Beginn. In diesen Studien soll die Wirksamkeit der Technik bei der Behandlung einer bestimmten Form von Arthrose, die die Kniescheiben betrifft (d. h. patellofemorale Arthrose), untersucht werden. Die Aktivitäten werden in Basel den Bereich der zellulären Therapien weiterentwickeln, der an der Universität Basel und am Universitätsspital Basel strategisch als Schwerpunktbereich für Forschung und Innovation definiert wurde.